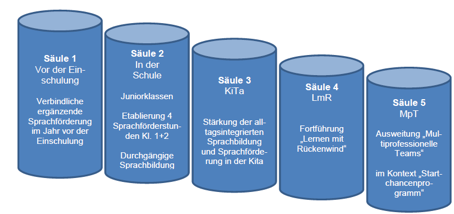Ostfildern: Wahl-Infostand
Ostfildern, Scharnhauser Park auf dem Marktplatz vor dem Stadthaus 9 Uhr
Nürtingen: Jetzt aktiv werden! Wir für Nürtingen
Nürtingen, Wochenmarkt, 09:00 Uhr
Esslingen: Infostand zur Kommunalwahl
Esslingen, 10:00 Uhr
Ostfildern: Wahl-Infostand
Ostfildern-Kemnat Hirschbrunnen 10 Uhr
Ostfildern: Fragen Sie Ihre Gemeinderats-Kandidat*innen: Stadtteilspaziergang Kemnat mit Andrea Lindlohr MdL
Ostfildern-Kemnat: 11.00 Uhr
Wolfschlugen: Ortsspaziergang Wolfschlugen mit Andrea Lindlohr MdL und Ihren Gemeinderats-Kandidat*innen
Wolfschlugen: 18.00 Uhr